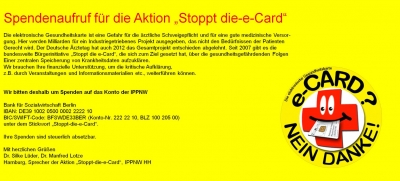Bei einer kürzlich in Berlin durchgeführten Pressekonferenz des Spitzenverbandes Bund der gesetzlichen Krankenkassen wurde erstmals die Katze aus dem Sack gelassen:
Spitzenvertreter der Kassen planen offensichtlich, mit Hilfe von auf der "Gesundheitskarte" gespeicherten genetischen Patientendaten vom Medizinischen Dienst der Kassen entscheiden zu lassen, welcher Patient ein Medikament für seine schwere Erkrankung erhalten soll, und welcher nicht. Es geht dabei um teure Medikamente zum Beispiel für die Behandlung von Hepatitis C oder Krebserkrankungen. Der Ärztenachrichtendienst (ÄND) berichtet am 15.6.2015 aus der Pressekonferenz des Spitzenverbandes Bund der Kassen:
"Vorstellbar wäre, dass der Medizinische Dienst der Krankenkassen auf Grundlage der Patientenakten festlegt, welche Patienten welches Medikament bekommen, sagte dazu Studienautor Busse. „Oder es wäre eine Anwendung auf der elektronischen Gesundheitskarte“, ergänzte Stackelberg. Damit könnte es einen verschlüsselten Austausch zwischen Kassen und Ärzten geben."
Wir dokumentieren hier mit Erlaubnis des ÄND des gesamten Bericht im Weiteren. Wir sehen uns hier deutlich in unserer jahrelangen Kritik an dem eGK - Projekt bestätigt. Die Intentionen der Beteiligten drehen sich eben nicht, wie immer wieder vom Gesundheitsministerium konstatiert, um medizinische Verbesserungen für Versicherte und Patienten, sondern es wird ganz deutlich dass es um Sparmaßnahmen, Rationierung und durch Kassen gesteuerte Versorgung ("Managed-Care Medizin") mit Hilfe von zentralisiert überwachten Medizindaten möglichst der gesamten Bevölkerung geht.
Arzneimittelerstattung
Kassen wollen
nicht mehr für alle Patienten zahlen
Der
GKV-Spitzenverband will Subgruppen von Medikamenten, bei denen kein
Zusatznutzen bewiesen ist, von der Erstattung ausschließen. Dazu sollen auch
Genotypen erhoben – und auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert
werden.
Das Amnog-Verfahren sollte nach
europäischem Vorbild verschärft werden, um so die Kassenausgaben für
Arzneimittel zu senken. Mit einem weitgehenden Reformvorschlag geht der
Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) jetzt an die
Öffentlichkeit – würde er umgesetzt, bedeutete dies massive Einschnitte für
Ärzte, Patienten und vor allem die Pharmaindustrie. In Rede steht unter
anderem, nur noch einzelnen Patientengruppen Medikamente zu erstatten, und zwar
jenen, bei denen ein Zusatznutzen feststellbar ist. Bisher gilt der Grundsatz,
dass Medikamente, bei denen für mindestens eine „Subgruppe“ im Amnog-Verfahren
(Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz) ein Zusatznutzen festgestellt wurde, dann
generell allen Patienten erstattet wird.
Das,
erklärte nun Spitzenverbands-Vize Johann-Magnus von Stackelberg am Montag in
Berlin, sollte sich ändern – und nur noch für Patienten gezahlt werden, die zu
der Subgruppe gehören. „In fast allen anderen europäischen Ländern haben wir
diese Differenzierung auch.“ Es seien auch Genotyp-Analysen denkbar, die auf
der elektronischen Gesundheitskarte eGK gespeichert werden könnten.
Grundlage
des Forderungskatalogs der Kassen ist eine Studie, die der Spitzenverband in
Auftrag gab und deren Ergebnisse nun vorgestellt wurden. Prof. Reinhard Busse,
Experte für Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin, verglich dafür die
Arzneimittelversorgung und deren Kosten in 16 europäischen Ländern und deren
gesetzlichen Krankenversicherungen. Demnach werden in Deutschland auch nach der
Einführung des Amnog-Verfahrens – also der frühen Nutzenbewertung mit anschließender
Preisverhandlung zwischen Kassen und Herstellern – Arzneimittel mit am
schnellsten auf Zusatznutzen überprüft.
Einher
gehe das mit einer deutschen Sondersituation: Dass nahezu alle Medikamente
erstattet würden. Anders als zum Beispiel in England, wo laut Busses Erhebungen
etwas weniger als jedes fünfte Medikament im Jahr 2012 von den Kassen
übernommen wurde, ein anderes Fünftel nicht. Besonderes Augenmerk galt dabei
den restlichen 60 Prozent in England: Hier nämlich gab es nur eine „bedingte
Erstattung“, ganz wie in anderen Ländern auch. Diese bedingte Erstattung kann
abhängig sein von der Indikation, der verordnenden Fachgruppe, dem
„Verordnungskontext“ oder „anderer Patientencharakteristika“.
„Wir
müssen uns mit Kostenaspekten der Verschreibungen beschäftigen“
Da
es in Deutschland diese Einschränkungen bei der Erstattung nicht gebe, so
Busse, hätten sich im Zusammenspiel mit steigenden Medikamentenpreisen in den
vergangenen Jahren die deutschen Kassenausgaben aus dem europäischen Mittelfeld
an die Spitze geschoben. „Wir haben in Deutschland kein Problem mit dem Zugang
zu neuen Medikamenten“, lautete sein Fazit. „Wir müssen uns aber mit den
Kosten- und Qualitätsaspekten der Verschreibungen beschäftigen.“ Was zur
Forderung des GKV-Spitzenverbands führt, die Busse so formuliert: „Um das
Preis-Leistungs-Verhältnis bei neuen Medikamenten zu verbessern, sollte auch
Deutschland eine gezielte Nutzungssteuerung bei neuen Arzneimitteln erwogen
werden.“ Da der Gemeinsame Bundesausschuss die frühe Nutzenbewertung bereits
auf Grundlage von Subgruppen durchführe, lägen die erforderlichen Daten auch
bereits vor.
Der
Verbands-Vize Stackelberg sieht in der Studie zunächst einen Beleg für die
generelle Kassenauffassung, dass es auch mit dem Amnog-Verfahren in Deutschland
ein gutes Innovationsklima für Arzneimittel gebe. „Innovationen sind direkt
nach der amtlichen Zulassung für alle GKV-Patienten verfügbar und damit auch
unmittelbar eine Einnahmequelle für den Hersteller – und das auf einem
überdurchschnittlichen Preisniveau.“ Das seit 2011 geltende Amnog-Verfahren sei
ein großer Fortschritt „gegenüber dem früher herrschenden Preisdiktat der
Industrie“, sagte Stackelberg. Nun aber seien neue Schritte notwendig, die der
Gesetzgeber einleiten müsste.
GKV-Spitzenverband
beklagt „Teppichhändlereffekt“
Stackelberg
thematisierte dabei auch den von vielen Gesundheitspolitikern und
Kassenvertretern immer wieder beklagten „Teppichhändlereffekt“. Denn nachdem
ein neues Arzneimittel zugelassen wurde, kann es der Hersteller zu einem nach
seinem Ermessen festgesetzten Preis auf den Markt bringen – die in
Verhandlungen nach der Nutzenbewertung festgesetzten Preise gelten erst ab dem
zweiten Jahr. Dies führt bisher oft dazu, dass zunächst völlig überhöhte Preise
verlangt werden, die die Kassen tragen müssen. Um dies zu ändern, so die
Forderung Stackelbergs, „wäre es sinnvoll, den Erstattungspreis rückwirkend
gelten zu lassen“. Den Herstellern sei diese Preisfindung zuzumuten, da sie auf
Erfahrung der eingespielten Amnog-Prozesse zurückgreifen könnten.
Auch
bei der umstrittenen Bestandsmarktregelung sieht der Spitzenverband offenbar
Handlungsbedarf. Beim Amnog-Verfahren nämlich sind bis jetzt nur Medikamente
erfasst, die neu auf den Markt kommen, alle anderen nicht. Stackelberg betonte,
„dass wir diese Regelung nicht durch die Hintertür auflösen wollen“, will aber
auch hier mehr Restriktionen. So sollten neue Indikationen bei bereits
eingeführten Medikamenten, anders als bisher, die frühe Nutzenbewertung
durchlaufen. Fielen sie durch, dürfte für diese Indikation nur noch die
günstigere Vergleichstherapie angeboten werden.
Die
umstrittenste der heutigen Forderungen allerdings dürfte die nach einer
Subgruppen-Unterteilung sein. „Die Gruppe, die keinen Zusatznutzen hat, sollte
von der Erstattung ausgeschlossen werden“, fasste Stackelberg zusammen. Dazu
könnten offensichtliche Indikatoren wie das Alter oder das Geschlecht
herangezogen werden, aber auch Genotypen, sagte er. „Wenn man den Startschuss
gibt, kann man auch kompliziertere Unterscheidungsverfahren machen. Dazu
brauchen wir aber eine Gesetzesänderung.“ Vorstellbar wäre, dass der
Medizinische Dienst der Krankenkassen auf Grundlage der Patientenakten
festlegt, welche Patienten welches Medikament bekommen, sagte dazu Studienautor
Busse. „Oder es wäre eine Anwendung auf der elektronischen Gesundheitskarte“,
ergänzte Stackelberg. Damit könnte es einen verschlüsselten Austausch zwischen
Kassen und Ärzten geben.
15.06.2015
16:21:42, Autor: aus Berlin: Thomas Trappe, änd
https://www.aend.de/article/158377